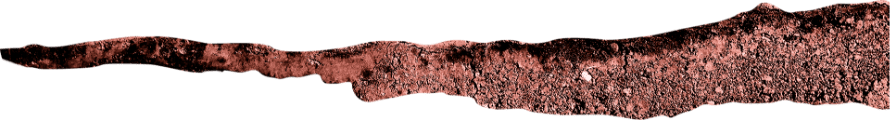
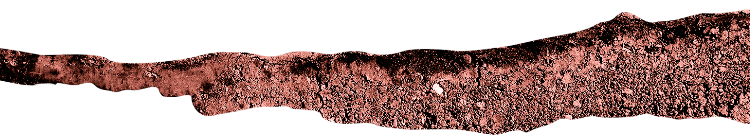
Was ist eine nützliche KI und wie unterscheidet man sie von einer nutzlosen KI?
SOCIO-ÖKOLOGIE DER DIGITALEN GOVERNANCE
Die versteckten Auswirkungen der KI zwischen ökologischen Kosten und Abhängigkeit
Künstliche Intelligenz setzt sich heute in einer Welt durch, die von tiefgreifenden ökologischen und sozialen Krisen geprägt ist. Dabei wird oft vergessen, dass die Digitalisierung nichts Virtuelles an sich hat. Unser vernetztes Leben basiert auf energieintensiven physischen Servern, die mit seltenen, aus dem Untergrund gewonnenen Materialien betrieben werden, und auf der unsichtbaren Arbeit Tausender Menschen, die die Algorithmen trainieren, moderieren und anpassen. Im Jahr 2024 verbrauchten Rechenzentren bereits mehr als 350 TWh Strom pro Jahr – so viel wie ein großes Industrieland. Jede Anfrage an eine generative KI verbraucht etwa zehnmal mehr Energie als eine herkömmliche Websuche, und das Training großer Modelle erfordert immense Mengen an Wasser zur Kühlung der Maschinen. Von der Gewinnung von Kobalt bis zur Gewinnung unserer Aufmerksamkeit setzt sich dieselbe extraktivistische Logik fort: Während wir von „magischen” Anwendungen profitieren, werden die energetischen und menschlichen Kosten hinter den flüssigen Schnittstellen verborgen.
Dieses Bewusstsein ist noch jung. Die ursprüngliche Utopie des Internets stellte die Technologie als emanzipatorisch und entmaterialisiert dar; aber mit der Machtübernahme durch Plattformen und Big Tech hat sich eine doppelte Abhängigkeit entwickelt: eine energetische Abhängigkeit von einer noch weitgehend fossilen globalen Infrastruktur und eine kognitive Abhängigkeit von Tools, die unsere Aufmerksamkeit filtern und einfangen. Technischer Fortschritt ist daher nur dann befreiend, wenn seine Architektur und seine Steuerung demokratisiert sind. Ohne dies führt Innovation zu neuen Formen der Knechtschaft – des Geistes und der Ressourcen. Daher der wachsende Ruf nach einer sozioökologischen Steuerung der Digitalisierung. Es geht darum, ökologische, soziale und politische Fragen bereits bei der Konzeption von Technologien zu berücksichtigen. Ohne Energiegerechtigkeit – d. h. eine gerechte und nachhaltige Verteilung des Zugangs zu Energie und Ressourcen – könnte der Aufstieg der KI Ungleichheiten und ökologische Krisen verstärken. Die zentrale Frage lautet: Wozu und wem dient die KI wirklich? Es muss unterschieden werden zwischen nützlicher KI, die dem Gemeinwohl dient, und nutzloser oder sogar schädlicher KI.
Unsere Vorstellungen von KI schwanken zwischen Faszination und Besorgnis. Auf der einen Seite wird sie in einem techno-lösungsorientierten Diskurs als Allheilmittel dargestellt, das alles lösen kann: heilen, vorhersagen, organisieren, reparieren. Auf der anderen Seite schürt Science-Fiction die Angst vor einem Ausufern: unkontrollierbare Maschinen, totale Überwachung, Verlust der menschlichen Kontrolle. Diese extremen Darstellungen haben einen perversen Effekt: Sie lenken von der wesentlichen Frage ab – welche Ziele verfolgen wir? Wenn wir KI als neutrales Schicksal betrachten, legitimieren wir ihren Einsatz ohne Debatte. Wenn wir sie hingegen verteufeln, berauben wir uns potenziell emanzipatorischer Werkzeuge. Eine andere, heimtückischere Vorstellung hat sich durchgesetzt: die des algorithmischen Komforts. Plattformen florieren, indem sie unserem Wunsch nach Bequemlichkeit schmeicheln: personalisierte Inhalte, kontinuierliche Unterhaltung, sofortige Dienstleistungen. Dieses Versprechen von Komfort führt zu einer Form der politischen Apathie: Warum ein System hinterfragen, das unser Leben vereinfacht? Hinter diesem Komfort verbergen sich jedoch die Vereinnahmung unserer Aufmerksamkeit, die Ausbeutung unserer Daten und die prekäre Arbeit einer Vielzahl unsichtbarer Mikroarbeiter. Sich dieser Vereinnahmung zu widersetzen bedeutet nicht, die Technologie abzulehnen, sondern die kollektive Vorstellungskraft neu zu beleben. Wie Bernard Stiegler betonte, prägt jede Technik unsere Denk- und Wunschmuster; sie erfordert daher eine Pharmakologie des Digitalen, die in der Lage ist, ihre positiven Anwendungen zu fördern und gleichzeitig ihre toxischen Auswirkungen zu begrenzen. Wir müssen uns also Technologien vorstellen, die offen für Zweifel und Komplexität sind und in der Lage sind, Fehler, Langsamkeit und Pluralität zu integrieren. Eine nützliche KI darf nicht die Kontrolle maximieren, sondern muss die menschliche Kreativität und die Autonomie der Gemeinschaften fördern. Die Vorstellungskraft wird hier zu einem politischen Instrument: Sie bestimmt den Weg, den unsere Beziehung zur Maschine nehmen wird.
Eine nützliche KI definieren: die wesentlichen Unterscheidungskriterien
Um eine nützliche KI von einer nutzlosen KI zu unterscheiden, kann man sich auf die von Elinor Ostrom formulierte Ethik der Gemeingüter und auf den Low-Tech-Ansatz stützen, der Bescheidenheit, Partizipation und Resilienz in den Vordergrund stellt. Eine wirklich nützliche KI erfüllt einen echten und messbaren Bedarf – Bildung, Gesundheit, Klimaanpassung, Solidarität – und begrenzt gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck. Sie muss nicht nach ihrem Gewinn, sondern nach ihrem kollektiven Nutzwert bewertet werden. Umgekehrt ist eine energieintensive KI, die dazu dient, Werbung zu optimieren oder übermäßigen Konsum anzuregen, eine soziale und ökologische Verschwendung. Sie folgt einer Logik der digitalen Genügsamkeit und strebt nach Effizienz statt nach Maßlosigkeit. Leichtere, lokal gehostete Modelle reichen oft aus, um eine Funktion zu erfüllen, ohne dass eine kolossale Infrastruktur aufgebaut werden muss. Algorithmische Sparsamkeit ist das digitale Äquivalent zu Reparatur und Wiederverwendung: Sie ermöglicht es, Leistung anhand der verfügbaren Ressourcen und nicht anhand der rohen Leistung zu denken. Aber auch die Governance spielt eine Rolle für den Nutzen. Eine KI ist nur dann nützlich, wenn sie transparent, kontrollierbar und kollektiv gesteuert ist. Dies setzt voraus, dass Nutzer, Arbeitnehmer und Gemeinschaften in die Definition ihrer Ziele und die Bewertung ihrer Auswirkungen einbezogen werden. Die Herausforderung knüpft an den Begriff der digitalen Gemeingüter an: ein System, das nicht von einem einzigen Akteur, sondern von einer Gemeinschaft nach expliziten und überprüfbaren Regeln verwaltet wird. Schließlich ist eine nützliche KI Teil einer symbiotischen Beziehung: Sie stärkt die menschlichen Fähigkeiten und trägt zur Erhaltung der Ökosysteme bei. Sie automatisiert nicht, um den Menschen zu ersetzen, sondern um ihm ein besseres Verständnis und Handeln zu ermöglichen. In der Landwirtschaft beispielsweise kann eine lokale KI, die bei der klimabedingten Planung von Anbaukulturen hilft, von großem Wert sein; eine undurchsichtige KI, die zu technologischer Abhängigkeit führt, wäre hingegen nutzlos oder schädlich.
Diese Kriterien definieren Effizienz neu: Es geht nicht mehr darum, schneller oder stärker zu produzieren, sondern innerhalb der planetarischen Grenzen sinnvoll und sorgfältig zu produzieren. Zahlreiche Initiativen skizzieren bereits diese nachhaltige Digitalisierung. Das Projekt BLOOM, an dem mehr als tausend freiwillige Forscher beteiligt sind, hat bewiesen, dass es möglich ist, offene, mehrsprachige und transparente Sprachmodelle zu erstellen. Ebenso entwickeln Kollektive wie Open Assistant KI, deren Code, Daten und Verzerrungen öffentlich zugänglich und diskutierbar sind. Open Source bietet somit Transparenz, gemeinsame Nutzung und lokale Aneignung. Es macht Innovation kumulativ und nicht wettbewerbsorientiert und ist ein Gegenmittel gegen die Konzentration von Wissen durch große Plattformen.
Die Forschung zu eingebetteter KI oder TinyML zeigt, dass es möglich ist, Tools mit sehr geringem Energieverbrauch zu entwickeln. Diese Lösungen ermöglichen beispielsweise die Überwachung der Bodenfeuchtigkeit, der Luftqualität oder der Straßenbeleuchtung ohne aufwendige Infrastruktur. Modelle wie DeepSeek, die für den Betrieb auf bescheidener Hardware ausgelegt sind, ebnen den Weg für Innovationen, die nicht von einem privilegierten Zugang zu Rechenleistung abhängig sind. Dieser erweiterte Low-Tech-Ansatz verkörpert die Konvergenz zwischen schlichtem Ingenieurwesen und Umweltethik. Gleichzeitig erweist sich kooperative Governance als wesentliche Voraussetzung. Das soziale Netzwerk Mastodon oder kooperative Plattformen wie Mobicoop veranschaulichen die Möglichkeit einer dezentralisierten und demokratischen Digitalisierung. Übertragen auf die KI würde diese Logik zu Plattformen führen, auf denen die Bürger gemeinsam über die Verwendung ihrer Daten entscheiden. Initiativen wie La Coop des Communs oder das Kollektiv Frugal Digital in Europa erforschen diese Modelle: polyzentrische Governance, Bürgerbeteiligung, offene Dokumentation, Volksbildung in digitaler Kultur. All dies sind Laboratorien für das, was man als zivile Intelligenz bezeichnen könnte.
Der Weg zu einer nützlichen KI – eine politische und kulturelle Entscheidung
Die Entwicklung einer nützlichen KI ist keine Utopie, sondern eine politische Entscheidung. Es geht darum, von einem algorithmischen Wachstumsmodell zu einer Kultur der Sorgfalt und des Maßhaltens überzugehen. Diese Umstellung basiert auf drei Prinzipien: radikaler Energieverzicht, um die materielle Belastung durch die Digitalisierung zu reduzieren; polyzentrische Governance, um die Entscheidungsgewalt zu verteilen; und offene Mitgestaltung, um Algorithmen überprüfbar und veränderbar zu machen. Wie Hélène Tordjman betont, ist Technologie kein Schicksal, sondern ein soziales Projekt. So wie Ostrom gezeigt hat, dass eine Gemeinschaft durch Beratung und geteilte Verantwortung aufrechterhalten wird, kann KI nur dann nachhaltig werden, wenn sie sich auf lebendige demokratische Institutionen stützt.
Politische Rahmenbedingungen beginnen sich abzuzeichnen: Die europäische Verordnung über KI (AI Act) schreibt Kriterien für Transparenz, Sicherheit und Verhältnismäßigkeit vor. Ihre Umsetzung muss jedoch von einer echten Bürgerdebatte begleitet werden: Wer definiert risikoreiche Anwendungen? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es für die automatisierte Überwachung? Schließlich muss algorithmische Gerechtigkeit die ökologische Gerechtigkeit ergänzen: Vorurteile überprüfen, Rechenschaftspflicht gewährleisten, Clickworker und von der Rohstoffgewinnung betroffene Gemeinschaften schützen.
Nützliche KI ist nicht die leistungsstärkste oder spektakulärste: Es ist diejenige, die die Menschenwürde und die Nachhaltigkeit des Lebens stärkt. Sie versucht nicht zu ersetzen, sondern zu verbinden. Sie verspricht keine Allmacht, sondern die kollektive Fähigkeit, die Welt mit Maß zu bewohnen. Zwischen der Illusion eines unendlichen Fortschritts und der Versuchung der völligen Ablehnung gibt es einen anspruchsvollen, aber fruchtbaren Weg: den einer Digitalisierung, die als Gemeingut geregelt ist, sparsam in ihren Mitteln und ehrgeizig in ihren Zielen. Das Neuschreiben des Codes einer bewohnbaren Welt beginnt hier: in der Art und Weise, wie wir unsere Technologien gestalten, teilen und begrenzen. Insofern ist die Sozioökologie der digitalen Governance keine Frage zusätzlicher Ethik, sondern einer kulturellen Neugestaltung. In einer Zeit, in der KI überall Einzug hält, geht es nicht nur darum, innovativ zu sein, sondern zu lernen, Technik, Gerechtigkeit und Leben gemeinsam zu denken. Vielleicht ist das letztlich die nützlichste Intelligenz.


