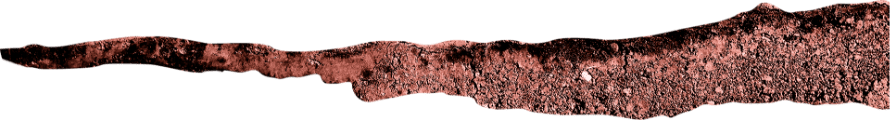
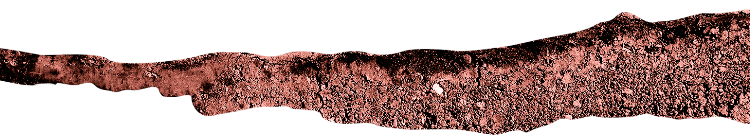
Von der Vision zur Aktion: Rückblick auf unsere transkontinentale Konferenz zur Bürgerresilienz
Eine Hybridveranstaltung zwischen Senegal, Togo und Luxemburg.
Vergangene Woche haben wir eine hybride Konferenz veranstaltet, die engagierte Akteur:innen aus Luxemburg, Togo und Senegal zusammenbrachte – mit einer zentralen Frage:
👉 Wie wird aus einer einfachen zivilgesellschaftlichen Diagnose eine wirklich transformative Handlung für ökologische, soziale und wirtschaftliche Resilienz?
Drei inspirierende Initiativen bildeten den roten Faden dieser kollektiven Erkundung.
Drei Regionen, drei verwurzelte und visionäre Ansätze
🇱🇺 In Luxemburg zeichnete Tarik Bouriachi die Geschichte des Äerdschëff nach – ein in Gemeinschaftsarbeit gebautes Low-Tech-Gebäude aus Reifen und Erde. Heute ist es nicht nur ein Ort, sondern ein lebendiges pädagogisches Labor für technologische Genügsamkeit. Daraus entstand auch der Fonds Citoyen de Résilience, ein Förderinstrument für Bürgerinitiativen in sieben Schlüsselbereichen – von Ernährung bis zur gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung.
🇸🇳 In Senegal stellte Constanze “Doudou” Sow die Ökologische Landuniversität Guélack vor, das Ergebnis von 35 Jahren praktischer Erfahrung. Ihr Leitprinzip: Learning by doing – mit Fokus auf Autonomie, ganzheitliche Lebensfähigkeit und generationenübergreifendes Lernen, umgesetzt in sieben vernetzten Bereichen: Agro-Pastoralismus, Biodiversität, ökologisches Gedächtnis, Handwerk, Wasser, einkommensschaffende Aktivitäten usw.
🇹🇬 In Togo präsentierte Sénamé Koffi Agbodjinou das Projekt Hub-City, ein Netz neovernakulärer Quartierslabore in städtischen Randgebieten. Sie bieten kostenlose Ausbildung, unterstützen Kooperations-Startups und entwickeln praktische Werkzeuge wie 3D-Drucker aus Elektroschrott, eine App zur Plastiksammlung und die Lokalwährung Scope – mit der Vision: „ein Earthship alle zwei Kilometer“.
Konferenzzusammenfassung
Gemeinsame Leitideen: Widerstand, Regeneration, systemische Kohärenz
Die Diskussionen brachten mehrere übergreifende Grundhaltungen hervor:
- Ökologische Wende als politischer Akt: Weg von individueller Schuldzuweisung – hin zur Transformation extraktivistischer Strukturen.
- Systemische Kohärenz als Richtschnur: keine isolierten Lösungen, sondern ganzheitliche Verknüpfung von Boden, Wasser, Energie, Kultur und Governance, mit transformativem Monitoring statt starrer Logikrahmen.
- Dekolonisierung von Vorstellungskraft und Technologien: mit Methoden wie Forumtheater, utopischen Romanen (Jahr 2075), kontextueller KI oder lokal verankerten Smart-City-Ansätzen.
- Jugend als zentrale Kraft: ob Open-Source-Bildung, Mutter-Satelliten-Farmnetzwerke, Open Code Academies oder künstlerisch-politische Workshops.
Herausforderungen – und konkrete Wege nach vorn
Die Beiträge machten auch die realen Spannungsfelder deutlich:
- Skalierungsfragen (z. B. müssen 60 Tonnen Plastik pro Tag gesammelt werden, um Scope zu stabilisieren)
- Politische oder rechtliche Hürden für Bürgergenossenschaften
- Gerechtigkeitsfragen in Armutskontexten
- Bedarf an geduldigem, offenem Finanzierungsrahmen
Aber konkrete Handlungsoptionen nehmen Form an:
- Lokalisierung von Low-Tech-Hubs und landwirtschaftlichen Schulzentren
- Stärkung Nord-Süd-Allianzen durch Verknüpfung von Lernorten
- Ausbau künstlerisch-partizipativer Formate zur Stärkung regenerativer Zukunftsbilder
- Aktivierung von Lokalwährungen zur Förderung zirkulärer Ökonomien
- Co-Entwicklung von Wirkungsmonitoring-Dashboards, die ökologische und soziale Resilienz verbinden
Ein wachsendes translokales Netzwerk
Die Konferenz hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Kraft in lokal verwurzelten Initiativen steckt, die Low-Tech, geteilte Governance und Wissens-Dekolonisierung verbinden.
Das Konsortium Résistances & Résiliences citoyennes versteht sich als Brückenbauer dieser translokalen Bewegungen:
- durch die Anpassung von Bildungsinstrumenten,
- durch die Stärkung von Akteur:innen-Netzwerken,
- durch die Schaffung von gemeinsamen Bürger:innenräumen, in denen Wissen zirkuliert, geteilt und multipliziert werden kann.
Denn der Wandel beginnt da, wo wir sind – mit all jenen, die gemeinsam neue Wege gestalten wollen.


